Namen: dtsch.:
Gemeine Wegwarte; niederl.: wilde cichorei; franz.: chicorée
sauvage; engl.: wild succory, chicory; ital.: cicorria comune;
span.: achicoria, amargón
Familie: Asteraceae -
Korbblütengewächs
Größe: 30-150
cm
Blütezeit: Juli bis Oktober
 Die
Wegwarte ist eine Pflanze, die vor allem an Wegrändern (!!!)
zu finden ist. Sie bevorzugt frische bis mäßig trockene
Ruderalstellen und kommt auch auf extensiv genutzten Äckern
vor.
Die
Wegwarte ist eine Pflanze, die vor allem an Wegrändern (!!!)
zu finden ist. Sie bevorzugt frische bis mäßig trockene
Ruderalstellen und kommt auch auf extensiv genutzten Äckern
vor.
Mit der Einführung des Ackerbaus aus Vorderasien um etwa 4500 vor unserer Zeit sind viele Ackerunkräuter eingeschleppt worden. Andere Pflanzen begleiteten die menschlichen Wohnstätten und Müllplätze. Diese, meist Stickstoff liebenden Arten, nennt man Ruderalpflanzen. Solche, in vorgeschichtlicher oder frühgeschichtlicher Zeit eingeschleppten Pflanzen, zu denen die Wegwarte gehört, werden als Archaeophyten bezeichnet.
Woher kommt der Name der Pflanze? Vielleicht aus der alten germanischen Legende die besagt, dass diese Pflanze eine verwunschene Jungfrau sei, die am Rande des Weges auf ihren Liebsten wartet.
 Die
Wegwarte ist eine ausdauernde Pflanze. Sie bildet eine
bodenständige Blattrosette und entwickelt gleichzeitig eine
unterirdische spindelförmige Rübe. Frühestens im
zweiten Jahr treibt sie den ersten Blütenstiel.
Die
Wegwarte ist eine ausdauernde Pflanze. Sie bildet eine
bodenständige Blattrosette und entwickelt gleichzeitig eine
unterirdische spindelförmige Rübe. Frühestens im
zweiten Jahr treibt sie den ersten Blütenstiel.
An dem
vergrößerten Ausschnitt des obigen Bildes kann man wie
bei der Kornblume recht gut erkennen,
dass es sich bei der Wegwarte um ein Korbblütengewächs
handelt. Man sieht innerhalb der äußeren Zungenblüten
die etwas dunkleren Röhrenblüten.
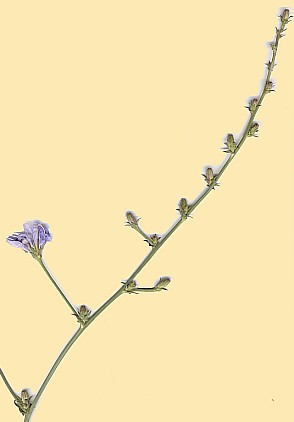
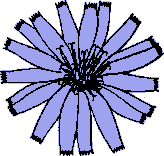 Sicherlich
hat beinahe jeder schon einmal eine Wegwarte gegessen - nur bringt
man das Gemüse selten in Verbindung mit der durch den
Straßenverkehr oft staubigen und wenig auffallenden Pflanze
am Wegesrand.
Sicherlich
hat beinahe jeder schon einmal eine Wegwarte gegessen - nur bringt
man das Gemüse selten in Verbindung mit der durch den
Straßenverkehr oft staubigen und wenig auffallenden Pflanze
am Wegesrand.
Die Rede ist vom Chicorée (Cichorium intybus
var. foliosum).
Der Chicorée ist eine in Kultur
genommene Wegwarte. Sie wurde um 1850 entdeckt, als ein belgischer
Bauer auf wilde Zichorien stieß, die unterirdische
Triebspitzen hatten. Später wurden diese Pflanzen durch den
Botaniker Brézier verbessert und es entstand der uns
bekannte Chicorée.
Näheres zum Anbau des Chicorées
ist bei den Links unten zu finden.
Bayerische
Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau
SWR-Kaffee
oder Tee - Mein grüner Daumen
Freundeskreis
Botanischer Garten Aachen (sehr gute Beschreibung der Pflanze,
ihrer Geschichte und ihrer heutigen Verwendung)
 Außerdem
wurde die Pflanze im 19. Jahrhundert ihrer Wurzel wegen
kultiviert. Sie wurde gemahlen und geröstet und diente unter
dem Namen „Zichorienwurzel“ als Kaffee-Ersatz.
Außerdem
wurde die Pflanze im 19. Jahrhundert ihrer Wurzel wegen
kultiviert. Sie wurde gemahlen und geröstet und diente unter
dem Namen „Zichorienwurzel“ als Kaffee-Ersatz.
Die Wegwarte ist schon lange bekannt. Sie wird bereits bei
Horaz, Plinius und Ovid als Gemüse und Heilpflanze erwähnt.
Neben ihrer Verwendung als Salat- und Gemüsepflanze sowie
als Getränk gilt die Wegwarte noch heute als Heilmittel. Ihre
Inhaltsstoffe (u.a. Bitterstoffe, Cumarine und Flavonoide) lassen
sie für den Einsatz vor allem bei Verdauungsstörungen
geeignet erscheinen. Außerdem findet sie Anwendung bei
Appetitlosigkeit, Leber- und Gallenleiden.
Ihr hoher Gehalt an Inulin sorgte dafür, dass die Wegwarte in den Blickpunkt der Lebensmittelindustrie geriet. Aus Inulin wird Oligofructose gewonnen, die als Ballaststoff dem modernen „functional food“ beigegeben wird.
Die Wegwarte war Bestandteil von Carl von Linnés
Blumenuhr in Uppsala (60° nördliche Breite). Die Blüten
öffnen sich dort zwischen 4 und 5 Uhr morgens und schließen
sich gegen 10 Uhr morgens. In unseren mitteleuropäischen
Breiten findet das Öffnen und Schließen später
statt. Nach meiner Beobachtung öffnen sich die Blüten um
etwa 7 Uhr und schließen sich erst am Nachmittag wieder.
Diese tagesrhythmischen Bewegungen der Blüten sind genetisch
vorprogrammiert und werden durch den Tag-Nacht-Zyklus
synchronisiert. Sie sind auch wetterabhängig.
Siehe hierzu
Botanik
online der Uni Hamburg.